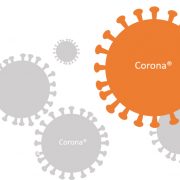Kaufdas…oder lass es besser sein! Verwechslungsgefahr bei Unionsmarken
Ein Online-Shop wollte den Namen „Kaufdas Online“ als Unionsmarke registrieren. Der EuG entschied jetzt, dass es eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Markennamen Kaufland und dem markenprägenden Bestandteil „Kaufdas“ gibt.
Das Gericht der Europäischen Union (EuG) musste im Streit zwischen den beiden Markenbezeichnungen eine Entscheidung fällen, da die Supermarktkette Kaufland gegen die Eintragung der Unionsmarke „Kaufdas Online“ Widerspruch eingelegt hatte.
Laut EuG besteht eine Verwechslungsgefahr bei den beiden Marken, da sie u.a. klanglich zu ähnlich sind. Beide Bezeichnungen haben nämlich dieselbe Anfangssilbe “Kauf“ und sind damit klanglich in der ersten prägenden Silbe identisch. „Eigentlich ist die Silbe „Kauf“ im Zusammenhang mit Handelstätigkeiten beschreibend und daher nicht schutzfähig,“ gibt NAMBOS-Geschäftsführer und Markenjurist Peter A. Ströll zu bedenken.
Aber das Gericht hat das im Zusammenhang mit nicht-deutschsprechenden Zielgruppen anders bewertet. So sollen beispielsweise Südeuropäer – wie Spanier und Italiener mit fehlenden Deutschkenntnissen – demnach die Marken “Kaufland” und “Kaufdas Online” leicht verwechseln können, da sich für sie der Bedeutungsinhalt nicht einfach erschließt und sie Marken daher nicht klar differenzieren können.
Daher wurde die Eintragung der Marke des Internetshops “Kaufdas Online“ als Unionsmarke abgelehnt.
„Den passenden und für Online-Shops im B2C oder B2B perfekten Markennamen zu finden, ist nicht einfach, da unzählige Unternehmen im Web um Aufmerksamkeit konkurrieren. Der direkte Wettbewerber ist häufig nur einen Treffer in der Trefferliste von Suchmaschinen entfernt. Zudem muss der Markenname für das eigene neue Unternehmen die gewünschten Assoziationen wecken und der Positionierung entsprechen. Außerdem sollte der Produktname oder Firmenname auch innovativ sein, ohne gleichzeitig gegen bereits existierende Markenrechte zu verstoßen. Daher muss eine Markenverletzung vor Nutzung eines neuen Namens mit einer Markenrecherche ausgeschlossen werden. NAMBOS sorgt hier für Sicherheit“, so NAMBOS-Geschäftsführer Recherche, Sebastian Fiebig.